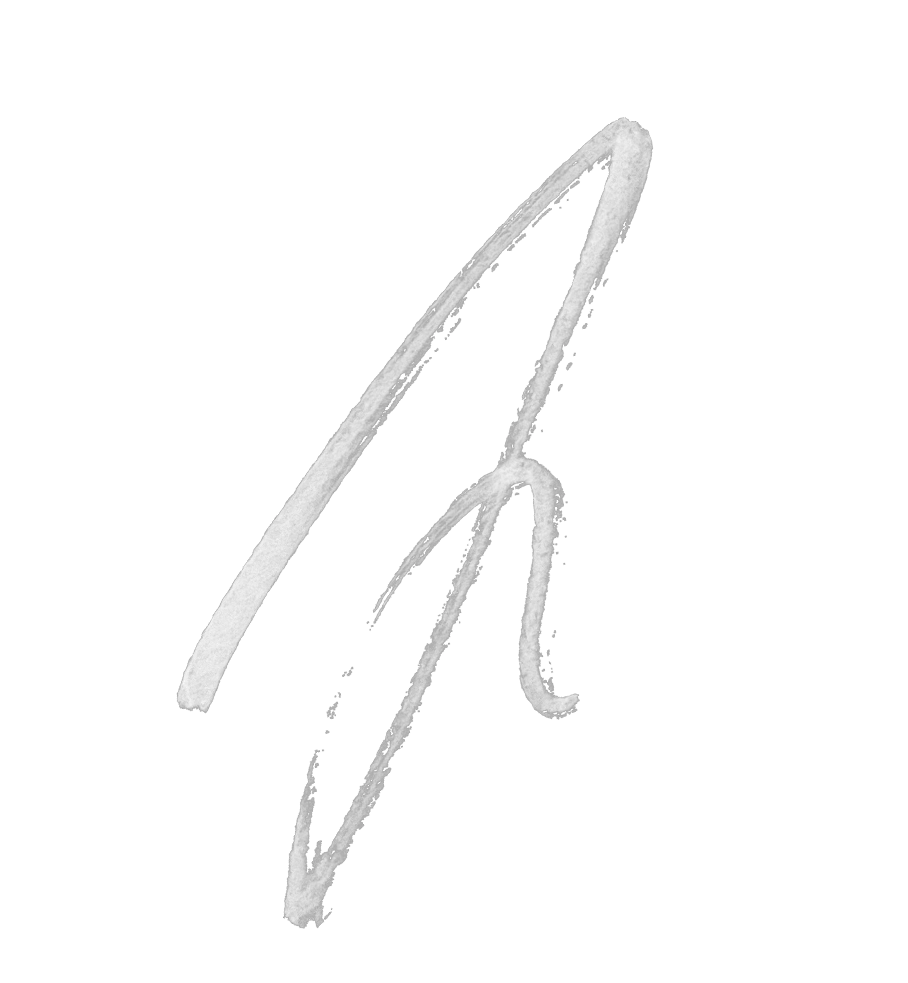Kulturelle Aneignung: Die Ukraine zwischen Geschichte und Gegenwart
Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Kampf um Geschichte. Von den Warägern über die Kosaken bis zur heutigen Weltordnung – wie Narrative geformt, instrumentalisiert und benutzt werden.
Ich bin weder Journalist noch Politiker. Aber ich beobachte diesen Krieg nicht nur aus der Ferne. Seit Jahrzehnten bin ich eng mit Russland verbunden – und spüre, dass dieser Krieg auch unser Leben betrifft. Nicht an der Front, sondern im Alltag.
Wenn ich die Flut an Kommentaren in den Medien und auf Social Media sehe, wird mir klar: die Welt ist komplexer, als es die Schwarz-Weiss-Muster suggerieren. Darum dieser Text – kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern der Versuch, historische Linien sichtbar zu machen, die bis in die Gegenwart reichen.
Von Ruderern zu Herrschern – die Geburt der Kiewer Rus
Karte der Kiewer Rus im 11. Jahrhundert – Wikimedia Commons, Public Domain
Die Ukraine ist kein junges Land ohne Geschichte. Im Gegenteil, sie steht am Anfang einer ganzen Region. Im 9. Jahrhundert gründeten skandinavische Händler und Krieger, die Waräger, ein Reich, das in den Chroniken als „Kiewer Rus“ bekannt wurde. Sie kamen mit Booten über die grossen Flüsse Osteuropas, ruderten, trugen ihre Schiffe über Land und verbanden Ostsee und Schwarzes Meer. Das Wort „Rus“ wird deshalb häufig vom altnordischen ruotsi abgeleitet – die „rudernden Männer“.
Kiew wurde rasch zum Zentrum eines Vielvölkerreichs. Es war ein Knotenpunkt zwischen Skandinavien, Byzanz und dem arabischen Raum. Sprache bewahrt dieses Erbe: Die Finnen nennen Russland bis heute „Venäjä“. Das Wort geht auf vene (Boot) zurück und bezeichnete ursprünglich die fremden „Bootsleute“. Während die Slawen aus „Rus“ „Rossija“ machten, hielten die Finnen am alten Namen fest. Für sie waren die „Russen“ ursprünglich nicht Slawen, sondern Wikinger.
Als Iwan IV., „der Schreckliche“, sich 1547 in Moskau zum Zaren krönen liess, beanspruchte Moskau das Erbe der Kiewer Rus für sich. „Zar“ stammt von Caesar und verlieh imperiale Legitimität. Damit begann die kulturelle Aneignung: Moskau stellte Kiew in seine Geschichtserzählung, obwohl es über Jahrhunderte ein eigenes Zentrum war.
Kosaken: Freiheit gegen Loyalität
Kosaken – legendäre Grenzkrieger, die Freiheit gegen Loyalität zum Zaren eintauschten.Stock Image 123rf
Ein weiteres Beispiel für dieses Spannungsverhältnis sind die Kosaken. Über Jahrhunderte lebten sie im Süden und Osten der heutigen Ukraine mit einem hohen Mass an Selbstverwaltung. Ihre Lebensweise war militärisch geprägt, ihre Gemeinschaften wählten ihre Führer selbst, ihre Freiheit war Kern ihrer Identität.
Doch ihre Autonomie war nie bedingungslos. Das Zarenreich liess sie gewähren, solange sie im Krieg für den Zaren kämpften. Die Regel war einfach: Wer ein Pferd hatte und in den Dienst des Zaren zog, durfte seine Freiheiten behalten. Ein Arrangement von Freiheit gegen Loyalität – und ein Symbol dafür, dass die Ukraine nie nur „Teil Russlands“ war, aber auch nie völlig unabhängig.
Diese Haltung prägte die Ukraine über Jahrhunderte: der Drang nach Autonomie, aber auch die Abhängigkeit von imperialen Zentren.
Holdomor, Erinnerung als Pflicht
Holodomor-Mahnmal in Kiew – Erinnerung an Millionen Hungertote in den 1930er Jahren. Stock Image 123rf
Ein Beispiel für den Kampf um Erinnerung ist der Holodomor, die Hungersnot der 1930er Jahre. Millionen Ukrainer starben, während die sowjetische Führung die Katastrophe systematisch verschleierte. Internationale Beobachter, darunter einflussreiche Journalisten in Moskau, verharmlosten oder leugneten sie. Erst Jahrzehnte später wurde der Holodomor als gezielte Hungersnot anerkannt.
Der Film Mr Jones" von Agnieszka Holland (ARTE in voller Länge) erinnert an dieses Kapitel. Er erzählt die Geschichte des britischen Journalisten Gareth Jones, der die Hungersnot dokumentierte und darüber berichtete, ohne Gehör zu finden. Für mich ist diese Geschichte ein Mahnmal: Wahrheit setzt sich nicht automatisch durch. Sie bleibt oft ungehört, wenn sie nicht ins politische Bild passt.
Identität ist kein „kleiner Bruder“
Der Schweizer Osteuropa-Historiker Andreas Kappeler hat es treffend formuliert: Der russisch-ukrainische Krieg ist auch ein Geschichtskrieg. Putin beruft sich auf die Kiewer Rus, um Russlands Anspruch zu legitimieren. Die Ukraine wiederum betont ihre Eigenständigkeit und verweist auf eine eigene historische Tradition. Der Westen konstruiert ebenfalls Narrative, etwa über Demokratie und Wertegemeinschaft.
Geschichte wird nicht neutral erzählt, sie wird instrumentalisiert – von allen Seiten.
Vom Kriegsschauplatz zur Weltordnung
Schaltzentrale amerikanischer Machtpolitik und Bühne globaler Entscheidungen. Stock Image 123rf
Im Hier und Jetzt geht es um weit mehr als Grenzen. Der Ukraine-Krieg ist zum Kristallisationspunkt globaler Machtfragen geworden. Und die letzten Tage haben das noch einmal deutlich gemacht.
In Alaska trafen sich Trump und Putin – ausgerechnet dort, wo Russland einst ein „wertloses“ Stück Land an die USA verkaufte. Nun wird dieser Ort zur Bühne, auf der über Krieg und Frieden in Europa verhandelt wird. Putins Angebot: ein Einfrieren der Frontlinien, wenn die Ukraine auf Donetsk und Luhansk verzichtet. Selenski lehnte entschieden ab – die ukrainische Verfassung lässt keine Gebietsabtretungen zu.
Gleichzeitig öffnete Putin die Tür für etwas Neues: Er akzeptierte grundsätzlich westliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, vergleichbar mit dem NATO-Artikel 5. Damit verschiebt sich das Spielfeld. Es geht nicht nur um Territorium, sondern auch um die Architektur der europäischen Sicherheit.
Die NATO und die EU ringen darum, ob sie diesen Schritt mittragen – zwischen Unterstützung der Ukraine und dem Risiko einer direkten Konfrontation.
Die USA sind militärisch und finanziell der wichtigste Akteur. Doch die innenpolitische Debatte in Washington ist gespalten. Je nach Ausgang der Wahlen könnte die Linie kippen.
Europa steht energiepolitisch und sicherheitspolitisch verletzlicher da denn je und muss sich fragen, wie eigenständig es überhaupt agiert.
China hält offiziell Neutralität, profitiert aber von einer Schwächung des Westens und positioniert sich leise als Gegengewicht.
Der Krieg ist damit längst kein regionaler Konflikt mehr. Er ist ein globales Ringen um Macht und Ordnung – und Alaska ist nur der Anfang. Die entscheidenden Gespräche folgen in Washington.
Die Illusion einfacher Antworten
Die Ukraine ist kein junges Land ohne Wurzeln. Von den „rudernden Männern“ der Kiewer Rus über die Kosaken bis zum Holodomor reicht eine Geschichte von Eigenständigkeit und Fremdbestimmung, von Aneignung und Selbstbehauptung. Heute setzt sich dieses Muster fort: Grossmächte verhandeln über die Ukraine, oft ohne sie, während Geschichte zur Legitimation genutzt wird.
Grenzen werden immer wieder neu gezogen. Die Welt ist nie gerecht. Politik handelt selten aus Idealismus, meist aus Eigeninteresse. Im Krieg gibt es keine Gewinner – nur Verluste.
Und vielleicht ist genau das die grössere Zumutung: Die Welt ist komplexer, als es viele Kommentare im Warmen mit kaltem Getränk suggerieren. Weniger Besserwisserei, mehr Demut vor dieser Komplexität – das wäre ein Anfang.
⸻
Weiterführende Quellen
• Encyclopedia of Ukraine: Normanist theory – Waräger und die Kiewer Rus
• Origins (Ohio State University): The Cossacks, Ukraine’s Paradigmatic Warriors
• Andreas Kappeler: Zur Gegenwart der Geschichte im russisch-ukrainischen Krieg (bpb, 2022)